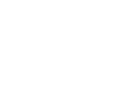Design Thinking
DT in der Lehrer*innenbildung
Theorie und Motivation
Empirische Bildungsforschung verlangt nach hoher wissenschaftlicher Rigidität. Die zu untersuchenden Variablen sollten möglichst genau kontrolliert und Kontexteinflüsse minimiert werden. Unterrichtsgeschehen ist aber komplex, dynamisch und kreativ; die individuelle Persönlichkeit der Lehrkräfte sowie die konkrete Unterrichtsorganisation vor Ort sind dominante Faktoren für den Lernerfolg und können für praxistaugliche Erkenntnisse nicht als Variable kontrolliert werden. Aus diesem Grund wenden wir Design Based Research als wesentliches Paradigma für unsere Arbeit in Forschung und Lehre an.
Ziel des Design Based Research ist nicht alleine, den „Unterricht ans Laufen“ zu bringen: Mit Hilfe von theoriebasierten Prototypen treten wir in einen Dialog mit den Lernenden und Lehrenden, für die wir entwickeln. Wir lernen mehr über ihre Bedürfnisse und suchen nach Einsichten in das menschliche Lernen, die wir zu übertragbaren und prüfbaren Hypothesen verdichten können. Damit entwickeln wir die Theorie des Lernens und Lehrens fortlaufend weiter.
Um zu übertragbaren Theorien zu kommen, müssen wir unsere Forschung aber dort beginnen lassen, wo jede Lerntheorie ihr Ziel und ihren Ausgang hat: Bei den „Usern“, den Lernenden und den Lehrenden.
Design Based Research Zyklus
Typisch für Design Based Research Projekte wie unsere ist ein zyklischer Verlauf. Die Zielsetzung eines Projektes ist theorie- und erkenntnisgeleitet. Das Projekt hat das Ziel, die Erkenntnisse über Prozesse des Unterrichts und des sozialen Miteinanders zu vertiefen sowie die Theorie des Unterrichtes in der Mathematik und den Naturwissenschaften zu erweitern. An der Planung eines DBR-Projekts werden Lehrer*innen, Fachdidaktiker*innen, Studierende, Schüler*innen und ggf. weitere Prozessbeteiligte frühzeitig einbezogen.
Die Entwicklung konkreter Interventionen wie z.B. Medien und Unterrichtsreihen – allgemein von uns als „Designs“ bezeichnet – findet in den dafür eingerichteten Laboren und Werkstätten des Instituts statt. Neuerdings werden wir hier durch die Competence Labs der Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung (ZuS) massiv unterstützt.
Nach der Ersterprobung der Prototypen findet die Implementation im Unterricht statt. Hierzu muss vielleicht unter mehreren Prototypen begründet entschieden werden. Auch Einzelentscheidungen über den Ablauf der Erprobung, über Eigenschaften, die geprüft werden, über Zeitplan und Rollen müssen getroffen werden. Hier geht der Kontext der Untersuchung – also das, was in Schule möglich ist und was nicht – erheblich in die Entscheidungsprozesse ein. Deshalb ist es wichtig, das alle diese Entscheidungen dokumentiert werden.
Während der Durchführung des Projektes muss fortlaufend überprüft werden, ob die Planung eingehalten wird. Abweichungen müssen begründet und dokumentiert werden. Sie geben möglicherweise wertvolle Hinweise auf den Kontext, in dem die Erprobung statt findet und dienen damit dem eigentlichen Forschungsziel. Die Auswertung des Zyklus’ besteht entsprechend aus einer Ergebnis- und einer Prozessreflektion.
Design Thinking als didaktisches Modell
Aufgrund des zyklischen Verlaufs von Design Based Research Projekten fällt es beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit schwer, den Ablauf in eine Publikation zu fassen. Sollen die Iterationszyklen einzeln beschrieben werden? Oder eine konventionelle Struktur mit Theorie-, Methoden-, Ergebnis- und Diskussionsteil darauf angepasst werden?
Die folgende Abbildung stellt ein allgemeines, didaktisches Modell für den Ablauf von Design-Projekten dar, das ab dem Studienjahr 2015 im Rahmen der Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung (ZuS) in unseren Lehrveranstaltung erprobt wird.
Für das Design Based Research im Rahmen der Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung abgewandelter Entwurf, basierend auf einem Konzept der HPI d.school, Potsdam.
Quelle: https://hpi.de/school-of-design-thinking/design-thinking/mindset.html – Lizenz: CC-BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Wir orientieren uns hierzu am „Design Thinking“ Workflow aus den Design Schools der Universitäten Stanford (d.school) und Potsdam (Fakultät für Software Engineering). Die Ergebnisse des Design-Prozesses werden 6 unterschiedlichen Stufen zugeordnet. Die Ergebnisse einer Iteration können dazu führen, dass man an unterschiedlichen Stellen neu beginnen muss: Einmal muss vielleicht lediglich der Prototyp angepasst werden, in einem anderen Fall kommt man zu einer neuen Ansicht auf den Prozess, die neue Ideen generiert und in einem Fall wurde uns sogar deutlich, dass wir die Forschungsfrage anders stellen müssen. Im Design Thinking wird entsprechend nicht von „Phasen“ gesprochen, die zwingend in dieser Abfolge durchlaufen werden müssen, sondern von „Mindsets“, in die man sich zur Lösung der Aufgabe versetzen muss. Beyl und Giese (2016) haben in ihrem Aufsatz gezeigt, dass Design-Projekte sehr unterschiedliche, auch sehr sprunghafte Verläufe mit vielen Rückschritten aufweisen. Sie haben im gleichen Aufsatz aber auch gezeigt, dass sich diese Abläufe mit einer einheitlichen Notation gut beschreiben und vergleichen lassen.
Beyhl, Th; Giese, H. (2016): The Design Thinking Methodology at Work: Capturing and Understanding the Interplay of Methods and Techniques. In: H. Plattner et al. (eds.): Design Thinking Research. Understanding Innovation. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40382-3_5/fulltext.html.
Ist Design Thinking das Gleiche wie Design Based Research?
Nicht automatisch! Aber mit überschaubarem Aufwand können Methoden aus beiden Konzepten integriert werden. Wir glauben nach über fünf Jahren Erfahrung daran, dass sich dieser Aufwand für beide Konzepte lohnt.
Design Based Research profitiert von den gut strukturierten Prozessen des Design Thinking, der ausgeprägten und gut umgesetzten Orientierung auf die Zielgruppe (bei uns: den Lernenden, Schüler*innen und Studierenden) und der Vielfalt an erprobten Methoden und Techniken des DT. Den Lernenden erschließt sich ein neuer Kosmos an Literatur, den Forschenden dazu auch weitere Publikationsmöglichkeiten.
Beiden Konzepten gemeinsam ist der iterative Zyklus, der Kreislauf von Design, Durchführung, Analyse und Redesign. Darüber hinaus ist die Vorgehensweise im Design Based Research nicht normiert, sodass jedes Design Thinking Projekt prinzipiell auch ein Design Based Research Projekt sein kann. Ausschlaggebend dafür, ob ein Entwicklungsprojekt Design Based Research genannt werden kann, ist aus unserer Sicht die Anwendung eines Satzes von Kriterien, die vom Design Based Research Collective (2003) herausgegeben worden sind. Damit profitiert auf der anderen Seite das Design Thinking von einer verstärkten Forschungsorientierung und wird zu einem theorien-generierenden Konzept.
Die wesentlichen Leitlinien für ein Design Based Research Projekt
- Das Design von Lernumgebungen muss verknüpft sein mit der Weiterentwicklung von Theorien des Lernens.
- Es findet ein Kreislauf von Design, Durchführung, Analyse und Redesign statt.
- Das Produkt der Forschungstätigkeit sind Proto-Theorien, die zwischen Forschung und Praxis ausgetauscht werden können und sich mit der Zeit immer mehr verallgemeinern lassen.
- Die Forschung soll untersuchen, wie sich bestimmte „Designs“ – beispielsweise mit brauchbaren Materialien ausgestattete Unterrichtsgänge – in echten Unterrichtssituationen bewähren.
- Die Reaktion aller Prozessbeteiligten – Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulleitung und Eltern – auf die eingesetzten Designs ist Gegenstand des Forschungsinteresses.
- Der Kontext „Schule“ wird nicht eliminiert, sondern mit einbezogen und soll die Erkenntnisse für die eigene Weiterentwicklung nutzen können.
- Entsprechend müssen die Forschungsmethoden so gewählt werden, dass sie den Verlauf des Unterrichtsversuches und die Interaktionen der Betroffenen dokumentieren und Ursache/Wirkungszusammenhänge aufklären.
Quelle: http://www.designbasedresearch.org/reppubs/DBRC2003.pdf
Ein wesentliches Qualitätskriterium der wissenschaftlichen Arbeit liegt also in der angemessenen Auswahl und Anwendung der Forschungsmethoden für den Test der Prototypen (Siehe hierzu den entsprechende Reiter). Ein Weiteres liegt in der Art und Weise, wie mit den generierten Erkenntnissen bzw. Prototheorien umgegangen wird.
Die im Verlauf des Prozesses erarbeiteten „Prototheorien“ werden so bezeichnet, um eine Analogie zu den „Prototypen“ zu bilden, mit denen Designer*innen komplexe Ideen und Konzepte kommunizieren. Ähnlich dienen Prototheorien der Kommunikation über die zugrundeliegenden Konzepte, Ideen und erste Befunde sowohl mit Lehrer*innen als auch mit Mitgliedern der Scientific Community.
DiSessa und Cobb (2004) sowie Prediger (2012) nutzen für das gleiche Konstrukt die Bezeichnung „lokale Theorien“, um den eingeschränkten Gültigkeitsbereich der Prototheorie nur für den untersuchten Kontext (z.B. den Physikunterricht der Klasse 10 einer bestimmten Schule) zu betonen. Dadurch wird implizit deutlich, dass eine Generalisierung der Befunde durch eine Verbreiterung der Untersuchungsbasis der nächste logische Schritt sein soll. Um diese Generalisierung vorzubereiten, sollen die lokalen Theorien sowohl Einsichten in die realen Lehr-Lernprozesse des untersuchten Unterrichts Schulen ermöglichen, als auch Prognosen und echte Handlungsleitlinien für das Lehrpersonal vor Ort bieten.
Entwicklung der Fragestellung
Ihr Verständnis der Fragestellung ist zum Beginn ihre private Annahme, die durch ihre bisherige Lebenserfahrung und Einflüsse aus ihrer Umgebung geprägt sei (Claudia Nicolai: “Your understanding are your assumptions, based on information & inspiration”). In dieser ersten Übung sollen Sie sich über diese Erfahrungen bewusst machen, sich gegenseitig darüber in Ihrer Gruppe austauschen und am Ende daraus eine gemeinsame Zielsetzung entwickeln. Sie werden erstaunt sein, wieviel Erfahrung Ihre Gruppe zu diesem Thema insgesamt schon einbringt. Jede dieser Erfahrungen kann und soll eine neue Idee inspirieren.
Deshalb wird es auch Ideen geben, die Sie am Ende der Sitzung fallen lassen müssen – aber erst am Ende der Sitzung! Schließen Sie eine gute Idee nicht zu früh aus. Und: es gibt keine schlechten Ideen!
Methoden zum Erfahrungsaustausch (Beispiele für das Seminar „Verkehrsphysik“).
Basierend auf: Both, TH: The Bootcamp Bootleg. S. 40. Stanford: d.School, https://dschool.stanford.edu/resources/the-bootcamp-bootleg, 2010. CC-BY-SA
Das „Feedback Capture Grid“ kann auch zum Sammeln von Erfahrungen in der Gruppe eingesetzt werden. Im vorliegenden Beispiel können Sie dem Straßenverkehr der Stadt Köln ein Feedback geben. Jedes Mitglied der Gruppe soll ein Post-it für jeden Quadranten beschreiben (max. 3 Zeilen pro Post-it, gerne mit Bild). Das Grid wird vorne an der Tafel gezeichnet, die Post-its werden von den Mitgliedern in den entsprechenden Quadranten eingesetzt. Anschließend wird innerhalb der Quadranten nach Ähnlichkeiten und Clustern gesucht.
Basierend auf: Meinel, Ch., Rhinow, H. Köppen, E.: Design Thinking Prototyping Card Set. Potsdam: Hasso Plattner Institut für Softwaresystemtechnik, 2013. S. 6. CC-BY-SA
Sie werden im Vortrag lernen, dass Emotionen wesentliche Modifikatoren für das Verhalten und für die unbewusste Entscheidungsfindung beim Autofahren ist. Umso wichtiger, dass Sie sich bei der Entwicklung von Lösungen Ihrer Emotionen zum Thema bewusst sind. Bei der „Brief an Oma“-Methode können Sie sich eine Bezugsperson vorstellen, bei der Sie gerne mal Dampf ablassen – d.h. der gegenüber Sie sich emotional ausdrücken und es gewohnt sind, Begeisterung und Frustrationen zu artikulieren. Schildern Sie dieser Person ein emotionales Ereignis aus Ihrer jüngeren Vergangenheit mit Bezug zu dem Thema. Schildern Sie sowohl, wie Sie das Ereignis verarbeitet haben, als auch welche Entscheidungen Sie daraus ableiten.
Entwicklung der Fragestellung
Die Zielformulierung und die Forschungsfragestellung sollen die gewünschte Verbesserung enthalten, eine Zielgruppe, die Sie zunächst in den Vordergrund stellen (später aber verändern oder erweitern können) und eine erste Idee der angewandten Methoden.
Beispiele:
- Wie können wir durch den Einsatz digitaler Medien den Einstieg in das Physikstudium für Erstsemester erleichtern?
(Aus Seminar „Vertiefung und Ergänzung der Experimentalphysik“, Mo 14-16) - Wieviel Energie können die Schüler*innen von Köln einsparen, wenn sie nur noch LED- oder Fluoreszenz-Lampen anstatt der herkömmlichen Glühbirnen verwenden?
(Aus Seminar „Neue Medien“, Mi 14-16) - Mit welchen Informationsangeboten können wir den Weg zur Schule für Grundschulkinder sicherer machen?
(Aus Seminar „Verkehrsphysik“, Mi 16-18) - Wie können wir das Studienprojekt im Praxissemester so gestalten, dass das Ergebnis für uns und für die Lehrer*innen der Praxisschule hilfreich ist?
(Aus Vorbereitungsseminar „Praxissemester“, Mi 8-10) - Wie können wir eine Ausstellung im Odysseum so gestalten, dass die Exponate für Besucher zusammenhängend und nachvollziehbar erscheinen?
(Aus Seminar „Forschen und Entwickeln im Unterricht“, Mo 17.45 - 19.15)
###
Sammeln Sie so viele Fragestellungen wie möglich. Vergeben Sie Punkte für Fragestellungen, mit denen Sie arbeiten können (z.B. vergibt jedes Gruppenmitglied zwei Punkte). Wenn eine Fragestellung ausgeschlossen werden muss, weil sie nicht genug Punkte erhalten hat, sollte in der Gruppe noch einmal herausgehoben werden, was an der Fragestellung gefällt. Eventuell kann man daraus Elemente für die anderen Fragestellungen gewinnen.
Empirische Daten sammeln und analysieren
Interview mit Vertreter*innen einer Zielgruppe
Aus Ihrem Verständnis der Fragestellung können Sie verschiedene Leitfragen entwickeln, die Sie betroffenen Vertreter*innen der Zielgruppe direkt stellen. Die Fragestellungen sollten den konkreten Alltag der Befragten berühren. Sie können Schüler*innen nach ihrem typischen Tagesablauf vom Aufstehen bis zum Weg zur Schule und von der Schule zurück nach Hause befragen und dabei herausfinden, wo die Schüler*innen welche Energieträger einsetzen. Vermeiden Sie bitte allgemeine Fragestellungen (z.B. „Wo wird die meiste Energie verbraucht?“), denn das bringt auch den/die Interviewpartner*in dazu, zu verallgemeinern. Dann hören Sie womöglich auch nur (falsche?) Verallgemeinerungen.
Vermeiden Sie eine konfrontierende Art des Interviews, ein „Ausfragen“. Bringen Sie stattdessen Ihre/n Interviewpartner*in dazu, Geschichten zu erzählen. Sehr hilfreich ist es, wenn Sie einen Gegenstand mitbringen, mit dem man sich gemeinsam beschäftigen kann. In der obigen Abbildung wurde dazu ein „Empathy Prototype“ benutzt: der/die Interviewpartner*in sollte typische, von Technik bestimmte Alltagsprozesse – z.B. das Durchführen einer Online-Transaktion – einer Emotion zuordnen, die durch einen bunten Smiley symbolisiert wurde. Daraus ergaben sich zwanglos viele, sehr aufschlussreiche Geschichten. Für ein Interview über die wahrgenommene Gefährdung im Straßenverkehr kann man sich an eine Kreuzung stellen und eine Zeichnung der Kreuzung auf einem Whiteboard oder ein Modell der Kreuzung mit Spielzeugautos mitbringen, das man gemeinsam belebt und gestaltet. Emphathy Prototypen und interaktive Gegenstände zeigen sich insbesondere als sehr hilfreich, um Sprachbarrieren zu überwinden!
Weitere allgemeine Hinweise für ein Interview (übersetzt aus: Both, TH: The Bootcamp Bootleg. S. 40. Stanford: d.School, https://dschool.stanford.edu/resources/the-bootcamp-bootleg, 2010. CC-BY-SA, Lizenz: CC-BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/):
- Fragen Sie nach dem Warum! Weshalb hat sich eine Person entschieden, gerade diesen Weg über eine Kreuzung zu wählen? Manchmal ist die Antwort überraschend und führt zu den Einsichten, nach denen man sucht. Wenn auf diese Art ein Gespräch zustande kommt, kann es gerne weitergeführt werden.
- Eine Person stellt die Fragen, eine andere Person zeichnet die Antworten auf. Alternativ oder zusätzlich können Sie das Interview aufzeichnen – aber das setzt das ausdrückliche Einverständnis des/der Interviewpartner*in/s voraus. Minderjährige können das Einverständnis nicht selbst erklären, hierzu ist die Zusage eines Erziehungsberechtigten notwendig – für ein Interview auf der Straße ist das aber nicht einfach herauszufinden.
- Achten Sie auf Gesten, Körpersprache und Inkonsistenzen. Manchmal ist das, was Personen tun, etwas anderes, als das, was sie sagen. Hinter diesen Inkonsistenzen können sich interessante Lebenserfahrungen verbergen.
- Wie im Gespräch mit der Klasse gilt: Keine Angst vor schweigenden Minuten. Lehrer*innen verfallen häufig in die Versuchung, das Schweigen mit Hilfestellungen zu „füllen“. Damit suggerieren Sie der Schüler*in oder den Gesprächspartner*innen eine sozial erwünschte Antwort, die jedoch nicht die eigene ist.
- Vermeiden Sie zu lange Fragesätze, die das Gegenüber auf eine falsche Spur bringen: 10 Wörter pro Fragesatz ist eine gute Faustregel!
Dramaturgie eines Interviews
(übersetzt aus: Both, TH: The Bootcamp Bootleg. S. 40. Stanford: d.School, https://dschool.stanford.edu/resources/the-bootcamp-bootleg, 2010. CC-BY-SA, Lizenz: CC-BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Wenn wir etwas Neues erfinden, möchten wir aus der Erfahrung einer Person schöpfen, um für sie neue Ideen und Problemlösungen zu entwickeln. Durch mehrfach durchgeführte strukturierte Interviews, die mit qualitativen Methoden ausgewertet werden, hoffen wir, zu Lösungen zu kommen und dadurch einer viel größeren Personen-Gruppe mit vergleichbaren Erfahrungen helfen zu können.
Die Erfahrungen einer Person speisen sich sowohl aus rationalen Gedanken als auch aus irrationalen Emotionen in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand. Diese Gedanken und Emotionen beeinflussen ihre Motivation und damit die Entscheidungen, die sie in Zukunft treffen wird. Diesen Zusammenhängen möchten wir auf den Grund gehen. Deshalb sind die Emotionen miteinzubeziehen.
Wenn wir eine bessere Lösung für den Mathematikunterricht entwickeln möchten, können wir Kinder bitten, Geschichten aus ihrem eigenen Unterricht zu erzählen. Diese Geschichten werden aufschlussreich sein, sind aber möglicherweise in der Erzählung „schöngefärbt“ und übertrieben oder cool und sachlich dargestellt. Nehmen Sie sich Zeit, die tatsächlichen Gefühle zu erkunden, die das Kind der Situation entgegen gebracht hat.
Dies wird Ihnen nur dann gelingen, wenn das Kind etwas Vertrauen zu Ihnen aufgebaut hat. Selbstverständlich dürfen Sie dieses Vertrauen nicht ausnutzen. Sie fragen dieses Kind, weil Sie helfen möchten und mit Ihrem Projekt die Situation für alle Kinder im Unterricht zu verbessern. Deshalb beginnt ein gutes Interview mit der Selbstvorstellung, der Vorstellung des Projekts und dem Versuch, einen emotionalen Bezug zwischen Ihnen, dem Kind und Ihrem Projekt aufzubauen. Dies wird als „Aufbau von Rapport“ bezeichnet.
Die AEIOU-Merkregel für Beobachtungen und Hospitationen
Durch die strukturierte Beobachtung des Verhaltens von Menschen lassen sich zusätzliche Informationen gewinnen.
Die „AEIOU-Regel“ soll helfen, sich mögliche Beobachtungsschwerpunkte zu merken und sie – wenn möglich – auf Mitglieder der Gruppe zu verteilen. Aus dem Englischen:
A – Aktion: Hier sollen die Aktionen von Menschen im Untersuchungskontext beobachtet werden. Dies kann die Unterrichtseröffnung einer Lehrkraft sein, das experimentelle Arbeiten eines/r Schüler*in/s, oder das Verhalten eines/r Verkehrsteilnehmer*in/s an einer Kreuzung.
E – Environment: Dieser Punkt dient der Beschreibung des Umfeldes selbst: Der Aufbau und die Gestaltung des Klassenraumes oder der befahrenen Kreuzung.
I – Interaktionen: Hier stehen die Interaktionen der Menschen und Objekte zueinander im Vordergrund. Wie reagiert ein/e Schüler*in auf die Unterrichtseröffnung der Lehrperson? Wie wird die rote Ampel von den Verkehrsteilnehmer*innen wahrgenommen? Achten Autofahrer*innen und Radfahrer*innen aufeinander?
O – Objekte: Hier geht es um die Beschreibung wichtiger Objekte im Raum – zum Beispiel verwendetes Laborgerät oder der physikalische Versuch. Im Fall der Verkehrskreuzung sind vor allem die gesichteten Fahrzeugtypen und ihre physikalischen Eigenschaften wie Größe, Anhalteweg und Übersichtlichkeit von Interesse, aber auch Verkehrszeichen und Ampeln.
U – User: Wir verwenden diesen Begriff nach Möglichkeit nicht, sondern ersetzen ihn direkt durch: Lernende / Lehrende / Verkehrsteilnehmer*innen. Hier soll eine Charakterisierung der typischen Akteure vorgenommen werden, die im folgenden Punkt auch für die Entwicklung der „Personae Prototypen“ genutzt werden kann. An der Verkehrskreuzung Dürener Straße / Gürtel treffen die „Nutzer*innen“ der Kreuzung – Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, Kinder auf dem Schulweg, LKW-Fahrer*innen, Straßenbahnfahrer*innen – aufeinander. Wie sind die Personenkreise zu charakterisieren? Unter welcher Perspektive sehen sie die Kreuzung und nähern sich ihr?
Extreme Fälle
Achten Sie grundsätzlich auf sogenannte Extreme User im Untersuchungskontext und beziehen sie diese mit ein. Ein/e Obdachlose*r, der/die sich den ganzen Tag in der Nähe der Kreuzung aufhält, hat möglicherweise ganz eigene und erhellende Erfahrungen mit der Kreuzung zu teilen. In einer Schule könnte man neben Lehrer*innen und Schüler*innen auch den/die Hausmeister*in befragen und dadurch zu einer völlig anderen Sicht auf Schule gelangen.
Verschiedene Ansichten vernetzen zu Personae Prototypes
Verschiedene Ansichten vernetzen
Versuchen Sie mit folgendem Schema, Ihre Beobachtungen und Gespräche in der Gruppe auszutauschen und zu verdichten. Die Daten können auf Post-Its symbolisiert, geclustert und neu zugeordnet werden. Ein Ziel kann die Beschreibung einer oder mehrerer möglichst guter Persona Prototypen (siehe oben ### ) sein.
- Mit wem haben wir das Gespräch geführt? Wen haben wir getroffen oder beobachtet?
- Gibt es Bilder, Videografien oder Original- bzw. Belegzitate?
- Gab es Momente, die uns überrascht haben?
- Wurden Widersprüche zwischen unseren Prä-Konzepten und der Beobachtung deutlich? Oder Diskrepanzen zwischen dem, was die Person gesagt und was sie getan hat?
- Welche ersten Fragestellungen können wir aus diesen Beobachtungen generieren? („Ich frage mich, ob das bedeutet...?“)
- Werden Bedürfnisse einer oder mehrerer der betrachteten Gruppen deutlich?
Beispiel von Studierenden der „Design Thinking Week“, HPI Potsdam: Interviews mit Bank-Nutzern.
Beschreibung und Synthese von Schüler*innen-Perspektive, Lehrer*innen-Perspektive und fachwissenschaftlicher Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand
Eine kennzeichnende Eigenart des Design Thinking, die sehr gut den Kölner Ansatz des Design Based Research ergänzt, ist das Sammeln verschiedener Ansichten auf einen Gegenstand und den Versuch einer Synthese. Dies ist in der Fachdidaktik der Naturwissenschaften schon sehr gut angelegt durch das Prinzip der „Didaktischen Rekonstruktion“ (Kattmann, Duit und Gropengießer, 1997).
Aus: Kattmann, Duit und Gropengießer (1997): Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion. Ein Rahmen für Naturwissenschaftsdidaktische Forschung und Entwicklung. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften (ZfDN), Jg. 3, Heft 3. Seite 3-18.
Das Modell der didaktischen Rekonstruktion hat sich in der Fachdidaktik der Naturwissenschaften auf breiter Ebene durchgesetzt. Aber wie soll man es in der Praxis handhaben? Die folgende Übung soll Ihnen helfen, die didaktische Rekonstruktion für Ihre Arbeit handhabbar zu machen. Wir lehnen uns hierzu an eine fundamentale Methode im Design Thinking an, der Entwicklung eines „Persona Prototypes“.
Ein grundlegendes Problem bei der didaktischen Rekonstruktion ist der Grad der Verallgemeinerung. Wir sollen die Perspektive eines/r Fachwissenschaftler*in/s einnehmen, aber jede*r der/die sich an der Universität aufhält, erkennt schnell, dass es sich um eine vielschichtige Personengruppe mit unterschiedlichen Charakteren und Ansichten handelt. Dies gilt genauso für Schüler*innen! Spätestens im Zeitalter von inklusiven und heterogenen Klassen muss jeder Versuch scheiten, Schüler*innen als normierte Gruppe zu behandeln. Letzten Endes kann es nicht das Ziel unserer Lehrer*innenbildung sein, Schüler*innen als Stereotypen oder anonyme Masse zu behandeln; im Gegenteil geht es um individuelle Diagnostik und Förderung.
Beim Persona Prototyp versucht man, die empirisch gewonnenen und geclusterten Daten zu einer möglichst tiefen Personenbeschreibung zu verdichten, die repräsentativ für eine interessante Teilgruppe der Befragten steht. Es handelt sich nicht um eine/n Interviewpartner*in, der/die unter falschem Namen neu auftaucht! Geben Sie der fiktiven Person einen Namen, ein Alter, ein Geschlecht und eine Geschichte. Was hat sie erlebt? Was denkt sie in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand? Was sind ihre Alltagsinteressen und Lebenspläne? Die getroffenen Aussagen sind mit Datenpunkten aus den Interviews oder aus anderen Studien (z.B. ROSE-Studie, IPN-Interessensstudie, Shell-Jugendstudie) zu belegen.
Ein Moodboard ist ein Hilfsmittel aus dem Kommunikation- und Mediendesign, mit dem die Lebenswelt, die Interessen und die Gegenstände des Alltags einer Person symbolisiert werden können. Es hilft sowohl dabei einen Persona Prototyp zu entwickeln, als auch dabei, sich mit ihm zu identifizieren. Um ein Moodboard für eine jugendliche Person zu gestalten, kann man sich vorstellen, wie das Zimmer und der Schreibtisch aussehen könnte. Dies kann mit ausgeschnittenen Beiträgen aus Jugendzeitungen geschehen oder durch das Studium öffentlich geteilter Seiten in sozialen Medien wie Snapchat, Instagram, Facebook oder Twitter. Durch ein Zusammenziehen der Begriffe „Internet“ und „Ethnographie“ hat diese Form der Sozialforschung die Bezeichnung „Netnographie“ erhalten. Die Abbildung zeigt eine Verbindung aus Personae Prototyp und Moodboard aus dem Seminar „Forschen und Entwickeln im Unterricht“ des Sommersemesters 2016. ###
Die spätere Entwicklung von Ideen und Interventionen geschieht für die vom Team entwickelten Personae. Auch bei der Planung der Evaluation ist es hilfreich, sich die Reaktion der Personae auf die Intervention vorzustellen und die Beobachtungsmethoden so zu wählen, dass die Reaktion gut erfasst werden kann.
Ideen generieren
Die Ideenfindung lässt sich in zwei wesentliche Phasen teilen: die divergente Phase und die konvergente Phase.
In der divergenten Phase sollen so viele Ideen wie möglich generiert werden. Dabei soll auf die Vorerfahrungen und das Vorwissen aufgebaut werden, welche(s) in den Vorgängerphasen gesammelt und durch Personaes, Emphathy Prototypen, Moodboards und die gesammelten Post-its der Interviews verdichtet wurden. Wichtig ist, dass man Ideen aufeinander aufbauen lässt. Hierzu müssen einige Regeln eingehalten werden.
In der konvergenten Phase soll die Gruppe aus der Vielzahl der Ideen schrittweise die Ideen auswählen, die in Prototypen realisieren werden sollen. Diese gegenständliche Realisierbarkeit ist gleichzeitig das wichtigste Auswahlkriterium.
Beide Phasen sollen sorgfältig voneinander getrennt werden, da sie zu bestimmten Mindsets der Gruppe gehören. Das ungebundene, emotionsbezogene und kreative Ideen-Generieren wird häufig auch als „Brainstorming“ bezeichnet. Es erfordert ein anderes Mindset als das kritische und analytische Evaluieren der Ideen auf ihrer Realisierbarkeit.
Vermischen sich beide Phasen, kann es dazu führen, dass gute Ideen zu früh abgewiesen werden, weil Emotionen anstatt rationale Kriterien die Auswahl beeinflussen. Ein Beispiel sind Entgegnungen wie „Das hat noch nie funktioniert“, „Das haben wir immer so gemacht“, „Ja, aber…“, die einer Idee entgegengebracht werden. Dies sind verbale Signale für Emotionen, z.B. die Angst vor dem Ausgang der Ideenfindung oder die Abwehr von Veränderungen, die den Prozess unbewusst beeinflussen.
Die Regeln für die Steuerung des Ideenfindungs-Prozesss sind weitgehend die gleichen, wie die für gutes Classroom Management:
- Nur eine Konversation gleichzeitig. Auf diesem Weg soll erreicht werden, dass eine Idee von allen Teilnehmer*innen gehört wird.
- Visuell arbeiten. Auch dies dient dazu, dass eine Idee von allen Teilnehmer*innen wahrgenommen wird. Zum einen können sich Personen mit einem eher bildhaften Gedächtnis visuelle Reize und kleine Skizzen sehr einfach merken. Zum anderen erleichtert das auch Personen mit Leseschwierigkeiten am Prozess teilzuhaben und fördert somit die Inklusion.
- Schlagworte nutzen – auch dies ermöglicht es vielen Menschen, sich die Idee hinter dem Schlagwort besser zu merken und sie im Prozess leichter zu handhaben.
- Auf den Ideen der anderen aufbauen. Das ist ein Kerngedanke des Design Thinking. Deshalb gibt es auch keine schlechten Ideen – denn auf jeder Idee kann man prinzipiell aufbauen.
- Bewertung kommt später! Keine einzige Idee soll in der divergenten Phase abgewiesen oder blockiert werden.
- Vielfalt der Ideen anstreben! Quantität geht zunächst vor Qualität. Die Natur ist ein Beispiel dafür, dass eine reiche Artenvielfalt (Biodiversität) stabile Ökosysteme hervorbringt, die sich wechselnden Umgebungsbedingungen anpassen können. Ähnlich soll hier eine Diversität von Ideen angestrebt werden, die sich im Anschluss dem Evaluationsdruck der konvergenten Phase stellen kann.
- Wilde Ideen sind willkommen! In einer Zeit der schnellen technischen Innovationen können wilde Ideen schneller Realität werden als man denkt.
- Auf die Ausgangsfrage fokussiert bleiben – kein Abdriften.
Auch in der divergenten Phase werden Ideen am besten auf einem Post-it fixiert. Hierzu sollte möglichst viel vertikaler Platz zur Verfügung stehen. Ideen werden spaltenweise gesammelt und können dann zum Clustern nach rechts übertragen werden.
Als Faustregel gilt, dass jede*r Teilnehmer*in in zwei Schritten das Whiteboard erreichen kann, um eine Idee zu fixieren. Generell ist viel Bewegung eine gute Idee: Die grundlegenden menschlichen und tierischen Problemlösungen ergeben sich aus der Bewegung: Einen Weg nach Hause finden, einer Bedrohung ausweichen, Nahrung suchen. Das Ideen-Finden, während man am Tisch sitzt, funktioniert deshalb auch bei modernen Menschen nicht optimal!
Um den Ideenprozess zu fördern, können deshalb vorab kognitiv anspruchsvolle Bewegungsübungen („Stokes“) durchgeführt werden. Wenn die Ideenfindung mitten im Prozess stockt, ist ein Eingreifen z.B. durch eine/n Teamleiter*in gefordert. Folgende Methoden sind hilfreich:
„How To“-Fragen stellen: Wie können wir dem/der Interviewpartner*in X bei seinem/ihrem Problem lösen? Wie können wir diesen Übergang sicherer gestalten?
Eine „Why-How“-Verknüpfung anbieten: Warum lassen Eltern ihre Kinder das Odysseum alleine erkunden? Wie können wir erreichen, dass die Eltern es stattdessen mit ihren Kindern gemeinsam erkunden?
Beschränkungen: Paradoxerweise können gerade Beschränkungen neue Ideen hervorrufen. Was, wenn alles nur aus Papier hergestellt werden darf? Was, wenn die Lösung nur wenige Zentimeter groß sein darf? Oder biologisch abbaubar sein muss? Wie hätte man das Problem ohne heutige Technologie etwa vor 200 Jahren gelöst?
Powers of Ten: Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Reframing. Das heißt, das Problem wird aus seinem jetzigen Kontext herausgenommen und in eine andere Größenordnung überführt. Mögliche Fragestellungen: „Was, wenn wir die Lösung nicht für 10, sondern für 10.000 Personen anbieten müssten?“ - „Was, wenn wir 1 Million Euro zur Verfügung hätten?“
Das Labor bietet Ihnen einen reichen Fundus an Daten, Technologien, Experimentiersammlungen, Informationen und Ansprechpartner*innen, mit bzw. von denen Sie sich für Ihre Problemlösung inspirieren lassen können. Weitere Hilfsmittel können sein: Datenblätter, Experimentiermaterial (Glühbirnen, Stromflussmesser, etc.) sein. Aber auch Unterlagen zu bekannten Lehrmethoden wie Predict-Observe-Explain (https://arbs.nzcer.org.nz/predict-observe-explain-poe) oder Gruppenpuzzle (http://methodenpool.uni-koeln.de).
Why-How-Laddering. Design Based Research bewegt sich in einem interessanten Spannungsfeld aus theoretischer Begründung auf der einen Seite und der Entwicklung unterrichtspraktischer Lösungen auf der anderen Seite (siehe erster Reiter: Überblick über die Einsatzbereiche des DBR). ###
Bei kaum einer Methode wird das so deutlich wie beim „Why-How-Laddering“ (BootCamp Bootleg, S. 20). Hier navigiert man das Spannungsfeld aktiv, versucht einerseits allgemeine Zusammenhänge zu erschließen, indem man „Warum“-Fragen stellt und andererseits praktische Lösungen zu entwickeln, indem man „Wie“-Fragen stellt.
Aus den praktischen Lösungsideen ergeben sich aber neue Begründungsfragen. Umgekehrt ergeben sich aus allgemeinen Zusammenhängen Ideen für praktische Lösungen.
Deswegen steigt man beim „Why-How-Laddering“ aktiv auf der Erkenntnisleiter zu mehr theoretischen Zusammenhängen auf (durch „Why“-Fragen) und wieder zu praktischen Lösungen ab (durch „How“-Fragen). Das ständige, miteinander verwobene Auf- und Absteigen erweitert das Verständnis der Gesamtsituation, des komplexen Problemnetzwerkes und der Verbindung des aktuellen Problems mit grundlegenden Theorien des Lernens und Lehrens.
Man geht dabei von einer Fragestellung aus, für die man annimmt, dass sie für viele Betroffene bedeutsam ist. Im Physikunterricht „richtig“ zu experimentieren wurde im Fachverbund Naturwissenschaften der Ausbildungsregion Köln als eine der zentralen Handlungssituationen identifiziert. Was aber bedeutet das?
Die Frage „Wie können wir Experimente im Physikunterricht effizienter einsetzen?“ wurde daher als Ausgangspunkt einer „Why-How-Ladder“ im Vorbereitungsseminar zum Praxissemester (SoSe 17) genommen. Die Frage „Warum?“ führte schnell zu den allgemeingültigen Formulierungen: „um den Kernlehrplan (für Physik) besser zu erfüllen“ oder „(um die) Modellbildung (besser zu) fördern“ – beides wesentliche Anforderungen an den Physikunterricht.
Wie soll man diese allgemeinen Anforderungen im Unterricht realisieren? Dies führt zu konkreten Anforderungen wie „Bewertungen initiieren“, denn Bewertungskompetenz zu fördern, ist eine Anforderung des Kernlehrplanes.
Wie kann eine Lehrkraft diese neue Anforderung konkret umsetzen? Die Studierenden erarbeiteten schnell eine Lösung: Schüler*innen sollen verschiedene Ausgänge von Experimenten (hier war das Beispiel ein „Eierfallversuch“) beobachten, den Ausgang vergleichen und günstige Konstruktionen bewerten. Zur Begründung ihrer Bewertung sollen sie auf bekannte Modelle und Konzepte der Physik wie dem freien Fall mit Luftreibung zurückgreifen.
Wie sollen die Schüler*innen diese komplexe Aufgabe erfüllen? Das geht bevorzugt in Gruppenarbeit.
Warum? Hier lohnt sich ein Rückgriff auf die Theorie kooperativer Lernformen (http://methodenpool.uni-koeln.de).
Wie können kooperative Lernformen hier eingesetzt werden, um Experimente im Unterricht effizienter einzusetzen? Unter anderem lassen sich Think-Pair-Share oder Expertenpuzzle einsetzen, damit Schüler*innen ihr unterschiedliches Vorwissen zusammentragen oder fehlendes Vorwissen zur Bewertung des Ergebnisses einsetzen können.
Ideen durch Prototypen (be-)greifbar machen
Die Aufgabe von Prototypen im Design Based Research
Bei komplexen technischen Fragestellungen ist eine Kommunikation, die nur auf Worten basiert, schwierig. Anschauungsmodelle haben in der Physik eine lange Tradition und helfen, die Kommunikation über einen Gegenstand in Gang zu bringen und zu vertiefen.
Anschauungsmodelle können kompliziert, aufwändig und teuer sein. Prototypen haben die gleiche Funktion wie Anschauungsmodelle:
- Sie informieren über die Funktion eines Gegenstandes: Wozu dient er? Im Fall eines Elektromotors besteht die Funktion darin, mit Hilfe elektrischer Energie ein Drehmoment für den Antrieb bereitzustellen.
- Sie informieren über den Aufbau eines Gegenstandes: Im Falle eines Elektromotors also einen Läufer, einen Stator zur Erzeugung eines Magnetfeldes, und eine Energiezuführung.
- Sie informieren über das Verhalten eines Gegenstandes: Da die Funktion eines Elektromotors zwingend mit der Drehung einer Antriebswelle verbunden ist, sollte diese Drehung im Prototypen sichtbar werden.
Das Kennzeichnende eines Prototypen ist, das er in keinem Fall ein endgültiges Modell darstellt – daher die Vorsilbe „Proto“. Er ist veränderungsfähig und kann vielleicht sogar während des Dialogs noch abgewandelt werden. Damit hat der Prototyp im Design Based Research die wesentliche Funktion der Gesprächsunterstützung, wie im nachfolgenden Bild dargestellt: ###
Prototypen evaluieren
Grundsätzlich können zum Testen der Prototypen alle Methoden der empirischen Bildungsforschung genutzt werden. Wir hatten bislang eingesetzt und mit aufschlussreichem Ergebnis ausgewertet:
- Teilnehmende Beobachtung
- Videographie
- Fragebögen
- Interviews mit Lernenden und betreuenden Lehrkräften
- Kompetenzzuwachs-Tests
- Qualitative Auswertung von Lernprodukten
Generell empfehlen wir den Einsatz von „Mixed Methods“ und eine Triangulation der Daten mit dem Ziel, die Wirkung des Prototypen auf das Feld unter möglichst vielen Gesichtspunkten und aus dem Blick von möglichst vielen verschiedenen Akteuren zu erfassen.
Videographien vom Unterricht mit Versuchsgruppen werden von den Competence Labs in der ViLLA-Datenbank gesammelt. Sie können innerhalb der Universität zu Köln betrachtet werden. Die Datenbank und ein Selbstlernmodul dazu finden Sie unter diesem Link:
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_1253256.html
Als Bewertungsbogen zur Unterstützung der „Teilnehmenden Beobachtung“ setzen wir die RTOP-Skala ein: https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/certop/interpret.html
Zur ersten Bewertung von Prototypen haben wir gute Erfahrungen mit folgendem Verfahren gemacht. Es ermöglicht zugleich die Teilnehmende Beobachtung, ein Feedback durch Freitextantworten und eine anonymisierte Bewertung. Die Zielgruppe kann dabei leicht in Untergruppen aufgeteilt werden, um z.B. die unterschiedlichen Sichtweisen verschiedener Geschlechter oder Interessengruppen einzufangen.
Es sollten aus einer Reihe von Prototypen, die durch Studierende im Seminar „Forschen und Entwickeln im Unterricht“ erstellt wurden, 3 Prototypen ausgewählt werden, die in funktionsfähige Versuche umgewandelt und im nachfolgenden Semester auf der ökologischen Rheinstation der Universität zu Köln eingesetzt werden sollten.
Die Studierenden organisierten hierzu einen Poster-Workshop, in dem der Versuchsprototyp vor einem möglichst informativen Poster ausgestellt wurde. Die Studierenden blieben zunächst mit im Raum, konnten auf Nachfragen der Schüler*innen reagieren und Teile des Versuchs erklären, die nicht selbstverständlich zu bedienen sind. Dies gab bereits informative Rückmeldung zur Gestaltung der Begleitmaterialien zum Versuch.
Im Anschluss wurden die Studierenden gebeten, den Raum zu verlassen.
Die Schüler*innen hatten vor Betreten des Raumes die Gelegenheit, sich je zwei Klebepunkte einer bestimmten Farbe auszusuchen. Sie wurden vom Testleiter darüber aufgeklärt, dass sie sich im Testraum alle Versuche anschauen und erklären lassen können. Auf der Ökologischen Rheinstation hätten sie aus Zeitmangel aber nur die Gelegenheit, 2 der 5 Versuche tatsächlich durchzuführen, die angeboten würden. Sie sollten je einen Klebepunkt auf die Poster der Versuche kleben, die sie wählen würden.
Ihre Auswahl sollten sie mit kurzen Texten begründen. Dazu wurden im Raum Post-it-Zettel in unbeschränkter Menge zur Verfügung gestellt, die die Schüler*innen ebenfalls auf die Poster kleben sollten.
Während die Farbe der Post-its ohne Belang war, wurden die farbigen Klebepunkte nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. Die Schüler*innen sollten sich:
- Zwei grüne Klebepunkte vom Stapel nehmen, wenn ihr Interesse an Physik „Hoch“ ist.
- Zwei gelbe Klebepunkte vom Stapel nehmen, wenn ihr Interesse an Physik „Mittel“ ist.
- Zwei rote Klebepunkte vom Stapel nehmen, wenn ihr Interesse an Physik „Gering“ ist.
Im Anschluss nach ausreichend Zeit ohne Aufsicht durch die Studierenden wurden die Schüler*innen aus dem Raum gebeten. Ihnen wurde für die Teilnahme gedankt und versichert, dass ihr Gutachten einen großen Wert für die weitere Entwicklung hat.
Die Studierenden müssen die Kommentare der Schüler*innen intensiv studieren, einordnen und ihre Interpretation zum Teil des Projektberichtes machen. Die Aufzählung der grünen, gelben und roten Punkte erfolgte zentral durch den Testleiter. Damit wurde eine Tabelle erstellt, die im Seminar präsentiert und allen Studierenden zur Verfügung gestellt wurde. Unter Zuhilfenahme der Freitextantworten und der Teilnehmenden Beobachtung konnte die Gruppe zu neuen und zum Teil sehr verblüffenden Erkenntnissen über die Sichten und die Interessen von heutigen Schüler*innen generieren.
Vor diesen Erkenntnissen mussten einige bislang als gesichert erscheinende Ansichten in Frage gestellt werden, zum Beispiel solche der IPN-Interessensstudie von 1995. Dies wird im Schaubild dargestellt durch die Pfeil, die von „Test“ zu den „Ansichten“ und von da aus ganz zurück zu der Ausgangsfrage führt. ###
Reflektieren, Lernen und den Einstiegspunkt für den nächsten Versuch bestimmen.
Für eine aktive Teilnahme wird vorausgesetzt, dass Sie an der Arbeit Ihrer Gruppe in allen oben dargestellten Phasen aktiv teilnehmen. Bitte tragen Sie sich gegebenenfalls in eine Liste in Ihrer Gruppe ein.
Für einen Leistungsnachweis muss sowohl das Produkt, das von Ihrer Gruppe erstellt und getestet wurde, als auch der gesamte Erstellungsprozess mit allen oben dargestellten Phasen dokumentiert werden. Bitte machen Sie ausgiebig Fotos und ggf. auch Filme von der Gruppenarbeit und den Zwischenergebnissen – z.B. Storyboards und Personae – oder sammeln Sie die entsprechenden Dateien in elektronischen Verzeichnissen ein. Damit gestalten Sie Ihr persönliches e-Portfolio, das für die Bewertung der Leistung herangezogen wird.
Zum Prozess
Weiterführende Literatur
- C. Meinel, L. Leifer: Understanding Innovation. New York: Springer, 2016. Erhältlich im Netzwerk der Universitätsbibliothek
- Both, TH: The Bootcamp Bootleg S. 40. Stanford: d.School, 2010. Lizenz: CC-BY-SA
- Häder, M: Empirische Sozialforschung: Eine Einführung. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer, 2016. Als E-Book erhältlich im Netzwerk der Universitätsbibliothek
- N. Sonalkar, A. Mabogunje, G. Pai, A. Krishnan, B. Roth: Diagnostic for Design Thinking Teams. New York: Springer, 2016. In: C. Meinel, L. Leifer: Understanding Innovation. Erhältlich im Netzwerk der Universitätsbibliothek
- Ryan, R and Deci, E.(2017): Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York; London: The Guilford Press Erhältlich im Netzwerk der Universitätsbibliothek
- Evans, J. (2003): In two minds: dual-process accounts of reasoning Trends in cognitive sciences Volume 7, Issue 10, October 2003, Pages 454-459 Erhältlich im Netzwerk der Universitätsbibliothek
STEAM: MINT kreativ vermitteln – kann das klappen?
Sind Mathematik, Informatik, die Naturwissenschaften und Technik dafür nicht viel zu trocken? Wer so denkt, sei herzlich eingeladen, einen Blick in die Ausgabe Nr. 9 (PDF, 6 MB) des Mediums „sonar“ der Deutschen Telekom Stiftung zu werfen. Auf den Seiten 12-15 dieser Ausgabe zeigen zwei Lehrkräfte, dass das geht. Und wie sie damit bei ihren Schüler*innen kreativ das Verstehen fördern.
Auf den Themenbereich Design Thinking@School nebst kostenfreiem Handbuch (PDF, 7 MB) sei ebenfalls hingewiesen.